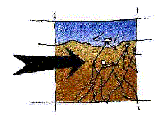
|
Krieg - Vertreibung - Exil |

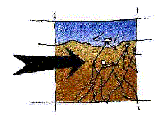 |
|
 |
Einige Hinweise und Anregungen
"Menschen auf der Flucht" - so der Titel dieses umfangreichen Kapitels, das Informationen über eine Reihe von heute noch verfolgten und vertriebenen Minderheiten vereint.
Es handelt sich vorwiegend um Materialien, die den Schülerinnen und Schülern einen allgemeinen Einblick in die Lage verschiedener Minderheiten geben können.
Der erste Teil des Kapitels enthält Texte, die auf die spezifische Situation in Südtirol eingehen. Einerseits wird die allgemeine Lage von Flüchtlingen in Italien und besonders in Südtirol beschrieben, andererseits werden die Lebensbedingungen der Sinti und Roma in unserem Land dargestellt. Ergänzt wird dieses Kapitel durch einen Beitrag über die Karrner.
Die Texte dieses Kapitels können gleichzeitig mit dem Material des ersten Kapitels über die Situation von Flüchtlingen und Zuwanderern in Südtirol behandelt werden. Wenn die Situation in Südtirol im Unterricht eingehend behandelt wird, so sollten die Schüler/innen die Gelegenheit bekommen, mit direkt Betroffenen oder mit Vertretern von Organisationen zu sprechen, die sich in Südtirol um Flüchtlinge und Zuwanderer kümmern. Im Anhang finden Sie eine Liste von Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind und auch gerne über ihre Arbeit und über die Situation in Südtirol berichten.
Der zweite Teil des Kapitels geht auf die Situation von Minderheiten in verschiedenen Teilen der Erde ein. Die Texte spiegeln die Situation bei Redaktionsschluss wider und liefern allgemeine Informationen über eine Reihe von Minderheiten.
Werden die Geschichte und die aktuelle Lage einzelner Minderheiten im Unterricht ausführlich behandeln, so muss auch auf die entsprechende Sachliteratur und auf aktuelle Presseberichte zurückgegriffen werden. Für Schüler ist es sicher interessant, sich die neuesten Informationen aus dem Internet zu holen.
Im Anhang finden Sie neben einer allgemeinen Literaturliste und einer Liste von Videos über die Lage von Minderhieten auch eine Reihe von Internet-Adressen, die es ermöglichen, sich allgemeine und aktuelle Informationen zu besorgen.
Schüler/innen könnten aus den Texten verschiedene Ursachen für Flucht, Verfolgung und Vertreibung herausarbeiten und sich mit der einen oder anderen Minderheit genauer beschäftigen. Die Statistiken über Flucht und Vetreibung am Ende des Kapitels sollen einen allgemeinen Überblick über die Phänomene Migration und Flucht geben.
Im Allgemeinen bietet das Thema Flucht und Vertreibung verschiedene Möglichkeiten fächerübergreifenden Arbeitens, z.B. zwischen den Fächern Geschichte und Erdkunde/Wirtschaftsgeographie.
Im Unterricht können entweder alle Texte des Kapitels oder auch nur einzelne Abschnitte behandelt werden. Vertiefungen und Ergänzungen müssen von Fall zu Fall entschieden werden. Dabei sollen allerdings wichtige Lernziele stets im Auge behalten werden:
Die Schüler/innen sollen einerseits den Zusammenhang zwischen Menschenrechts- und Minderheitenproblematik erkennen, andererseits soll ihnen bewusst werden, wie viele Minderheiten es gibt, welch große Bedeutung Flucht und Vertreibung in unserer Zeit spielen und wie es um die Rückkehrmöglichkeiten von Vertriebenen bestellt ist.
Sofern nicht
anderes angegeben, stammen die Texte des Kapitels von
Mitarbeitern der GfbV.
Der Staat aktivierte zusammen mit der Landesverwaltung und Freiw.illigen-Organisationen die Betreuung. Nach relativ kurzer Zeit wurde die Kaserne in Welsberg geschlossen, viele Albaner kehrten in ihre Heimat zurück, andere blieben in Südtirol, fanden Arbeit und Unterkunft.
Laut italienischem Gesetz (Flüchtlinge kommen aus einem Land, in dem deren Leben gefährdet ist oder in dem Krieg herrscht) waren und sind diese Albaner eigentlich nicht als Flüchtlinge einzustufen, viel eher als "Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern". Daher gelten hier auch wieder andere Gesetze und Bestimmungen.
Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien
1991 beginnt der Zerfall der Sozialistischen Republik Jugoslawien. Serbien versucht die Autonomie-Bestrebungen der einzelnen Republiken mit Gewalt zu verhindern. Hunderttausende Menschen, zuerst in Kroatien, später in Bosnien-Herzegowina (anschließend Kosovo) verlassen ihre Heimat und fliehen in das Ausland.
Da Kroatien, später auch Bosnien, sich zu unabhängigen Staaten erklären und auch von der internationalen Gemeinschaft als solche anerkannt werden, handelt es sich bei diesem Konflikt nicht mehr nur um eine "innere Staatsangelegenheit", sondern um einen Krieg zwischen verschiedenen Staaten. Dieser - für uns vielleicht unwichtige - Unterschied ermöglicht es den fliehenden Massen, in den Nachbarländern und darüber hinaus, Aufnahme als Flüchtlinge zu erhalten.
Flüchtlinge in Italien
Italien ist als direktes Nachbarland von Kroatien von Anbeginn von den kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen. Gleich zu Beginn des Krieges in Kroatien kommen die ersten Flüchtlinge nach Italien, wenn auch Österreich und Deutschland die Hauptaufnahmeländer sind.
In der Folge, mit der Ausweitung des Krieges auf Bosnien-Herzegowina, aktiviert der Staat selbst eine Flüchtlingshilfe und bietet über die UNO Bosnien die Hilfe an und ist bereit, Flüchtlinge in organisiertem Stil aufzunehmen. Der Staat stellt im gesamten Staatsgebiet aufgelassene Kasernen zur Verfügung und organisiert zusammen mit dem Roten Kreuz die Transporte nach Italien. Außerdem garantiert der Staat die Versorgung dieser Flüchtlinge.
Neben diesen, durch die staatlichen und internationalen Stellen organisierten Evakuierungen, gibt es noch viele Flüchtlinge, die sich auf eigene Faust nach Italien durchschlagen und hier Aufnahme erhalten haben. Dabei spielt es keine Rolle - zumindest anfänglich - ob die Grenze nach Italien legal oder illegal (d.h. ohne gültige Einreisedokumente, Anmerk. d. Red.) überschritten wurde. In jedem Fall wurde dem Menschen eine Aufenthaltgenehmigung aus "humanitären Gründen" (permesso di soggiorno per motivi umanitari) ausgestellt. Es reichte, dass die betreffende Person die Herkunft aus dem Kriegsgebiet nachweisen konnte (kann). Im Unterschied zu den erstgenannten Flüchtlingen (welche durch staatliche Stellen vermittelt wurden), kommt den "einzeln" eingereisten Personen keine weitere staatliche Hilfe zuteil.
Bis Mai 1993 war dies ein besonderes Problem, weil Flüchtlinge keine Arbeitserlaubnis erhielten. Mittlerweile haben sich die Bestimmungen in diesem Punkt geändert, sodass auch ein Flüchtling einer regulären Arbeit nachgehen darf.
Flüchtlinge in Südtirol
Im Mai 1992 werden in Südtirol über Nacht zwei aufgelassene Kasernen zu Flüchtlingsauffangzentren umfunktioniert: in Mals und in Wiesen.
Lediglich wenige Stunden vor der Ankunft wurden die zuständigen Stellen von der Ankunft von 420 Flüchtlingen, vornehmlich Frauen und Kinder, verständigt.
Auf Landesebene wurde ein lockeres "Bündnis" zwischen Staat, Provinz Bozen und der Cartias eingegangen, um die Menschen in diesen beiden Kasernen zu betreuen.
In jeder Kaserne wird ein Mitarbeiterstab eingerichtet, der sich aus Mitarbeitern des Regierungskommissariats, der Caritas und aus Freiwilligen zusammensetzt.
Auf Grund des Landesgesetzes ist es möglich, den Flüchtlingen schon sehr bald eine Art Taschengeld auszubezahlen. Dies ermöglicht ihnen eine gewisse Unabhängigkeit und verleiht ihnen auch eine gewisse Würde. Die Kinder werden in die verschiedenen Schulen eingeschrieben und besuchen italienische oder deutsche Schulen, je nach Präferenz und eventuellen Vorkenntnissen.
Für die Erwachsenen ist die Integration in das lokale Umfeld weitaus schwieriger, da sie bis Sommer 1993 vom aktiven Arbeitsprozess ausgeschlossen bleiben. Wohl auch deshalb, weil man erst jetzt erkannt hat, dass der Aufenthalt der Flüchtlinge noch von längerer Dauer sein wird.
Flüchtlingskinder in Malser Schulen
Die Leistungen der Schüler sind durchschnittlich gut. Die Aufteilung der Pflichtschüler auf verschiedene Gemeinden und Klassen hat sich bewährt. Weiters hat es sich sehr bewährt, dass von Seiten der Caritas und des Schulamtes den Schülern auch die Möglichkeit geboten wird, im Rahmen des normalen Unterrichts und in gewissen Stunde (z.B. Religion) die serbo-kroatische Sprache in Wort und Schrift zu lehren. Es ist dies eine Initiative, um den Schülern bei einer eventuellen Rückkehr in die Heimat zu ermöglichen, sofort wieder in die dortigen Schulen und Lernprogrammen einsteigen zu können.
Flüchtlinge außerhalb der Kasernen
Im Laufe des Jahres 1995 wendeten sich 207 neu angekommene Flüchtlinge an die Flüchtlingskontaktstelle der Caritas in Bozen. Im Gegensatz zu jenen in den Kasernen ist das Leben für diese einzelnen ankommenden Flüchtlinge wesentlich schwieriger. Wichtigste Maßnahme ist vor allem die Suche nach einer dauerhaften Unterkunft und nach einer längerfristigen Arbeit, die es dem Flüchtling ermöglicht, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Von Seiten der Caritas können hier nur Übergangslösungen angeboten werden, vor allem so lange, bis die juridische Situation der betreffenden Person in Kontakten mit der Quästur geklärt ist.
Bei diesen Flüchtlingen handelt es sich vornehmlich um junge Männer, seltener um Familien. Die Männer sind vielfach Wehrdienstverweigerer, die wohl auch für längere Zeit nicht mehr nach Bosnien zurückkehren werden können.
Für Flüchtlingen außerhalb der Kasernen gestaltet sich das Leben weitaus schwieriger als für jenen in der Kaserne. Es fehlen oft die sozialen Kontakte, der Flüchtling ist auf sich allein gestellt, muss alle Wege alleine gehen und sich die Informationen alle erst selbst besorgen. Eines kann über einen Dolmetsch-Dienst von der Caritas behoben werden, allerdings bleibt die relative "Verlorenheit" jener Flüchtlinge, die keine Unterkunft in den Kasernen finden.
Von Franz Kripp, Direktor der Caritas der Diözese
Bozen-Brixen 1996
Die Gruppe setzt sich aus Familienangehörigen der Gabrielli und Ferrari zusammen. Beides Sippen, die sich zur österreichischen Gruppe der Sinti Estrekharia rechnen. "Mir sein deitsch", erklärt die 58-jährige Natalina Ferrari, ihr Sohn hat noch die österreichische Staatsbürgerschaft.
In der Genuastraße hat auch Gianfranco Gabrielli, einer der Sprecher der Sinti in Bozen, seinen Wohnwagen stehen. Dunkelschwarzes Haar, braune Haut, zwei Meter groß, ein Sinto, wie er nicht im Bilderbuch steht. Er schaut aus wie ein Mexikaner, Bluejeans, Stiefel und Jeanshemd. Gabrielli gehört zu jener jungen Sinti-Generation, die um die Anerkennung ihres Volkes als ethnische Gruppe kämpft. Sie bittet um die Zuweisung von Rastplätzen, um dort unter sich sein zu können und um einen festen Wohnsitz zu haben.
"Wir verlangen nichts anderes, als dass uns die Polizei nicht dauernd verjagt", sagt Gabrielli entschlossen. Kaum dass in Bozen ein Einbruch verübt, eine Bank überfallen werde, tauchten die Carabinieri mit Maschinengewehr und Sirenengeheul bei den Sinti auf und starten dort eine Razzia. Auch wenn wir damit nichts zu tun haben, werden wir von den Autoritäten ständig für irgendwelche Missetaten verantwortlich gemacht", wettert Gabrielli. Ein Problem, das die Sinti immer wieder in die Illegalität drückt, in die rechtlose Grauzone der durchorganisierten Gesellschaft.
Und die Sinti leben am Rande dieser Konsumgesellschaft. Allein in Bozen sollen es laut Volkszählung von 1981 an die 300 sein, weitere 200 Sinti und Roma leben im Lande verstreut. Die meisten von ihnen sind bitterarm, Analphabeten und zum Teil vorbestraft. Voraussetzungen, nie aus der Armut entfliehen zu können.
Vor zwanzig Jahren nahm der Geistliche Bruno Nicolini seine Sozialarbeit für die Sinti in Bozen auf, gründete dafür in Bozen das inzwischen gesamtstaatlich organisierte Nomadenwerk "opera nomadi". Das Nomadenwerk kümmert sich um die Aufenthaltsgenehmigung, wurde zum zentralen Postkasten für die Sinti-Gemeinschaften, bemühte sich um kriminell gewordene Sinti. Zum Werk stieß in den sechziger Jahren die Lehrerin Sandra Carli, die in einer vom Staat finanzierten Sonderschule Sinti-Kinder aufnahm und unterrichtete. Sie wurde zur Vertrauensperson der Sinti, ähnlich wie der Eppaner Seelsorger Bruno Carli, der in den letzten Jahren der "opera nomadi" vorsaß. Immer wieder forderte das Nomadenwerk von der Gemeinde Bozen die Schaffung fester Rastplätze für die Sinti und mehr Toleranz.
Dem Nomadenwerk in Bozen gelang es, die Türen der Schulen für die Sinti-Kinder aufzusperren. Bis zu 30 schulpflichtige Kinder besuchten seitdem jährlich die Schule. Es komme aber immer wieder vor, dass Sinti-Schüler irgendwann nicht mehr kommen, weil die Polizei deren Eltern kurzerhand verschickt habe, erzählt Bruno Carli. Diese Kinder würden zur Armut verdammt werden, zum Stehlen. Denn Analphabeten könnten nie eine Lizenz beispielsweise als Wanderhändler erhalten, keinen Führerschein, hätten kaum Aussicht, eine Arbeit zu finden.
"Zigeuner stehlen und rauben, sie sind arbeitsscheu, kurzum ein Gesindel", so lautet die Volksmeinung. Giancarlo Gabrielli streitet dann auch gar nicht ab, dass manche der Sinti in Südtirol stehlen. Doch vielfach würde ihnen gar keine Chance gelassen. Wer gibt einem Sinto auch schon Arbeit? Der Sinti-Seelsorger Bruno Carli argumentiert ähnlich: "Wir beschuldigen sie, nicht arbeiten zu wollen, aber Arbeit für sie gibt es nie". Carli kritisiert auch das Vorurteil, dass alle Sinti stehlen. Dabei würden die Kapitalverbrechen von Nicht-Sinti ausgeführt werden. Wir würden Hühnerdiebe sofort einsperren lassen, aber nicht Leute, die Milliarden unterschlagen. Um die Verelendung und Kriminalisierung zu stoppen, so Gabrielli, sei die Einrichtung von festen Rastplätzen mit fließendem Wasser und Toiletten der einzig richtige Schritt. Ihre Bitte trug eine Sinti-Delegation auch Bischof Joseph Gargitter vor.
Bereits vor einem Jahr sollte ein von der Kurie an die Grundfürsorge abgetretenes Grundstück in Gries, einem Ortsteil von Bozen, als Rastplatz den Sinti zur Verfügung gestellt werden. Doch die Bauern wollten davon nichts wissen. In einem offenen Brief protestierten sie gegen dieses Projekt. Der Bozner Gemeinderat lehnte dann auch die Errichtung eines Nomadenplatzes in Gries ab. Es sei für die Bevölkerung ein zweitrangiges Problem. Das Thema fiel unter den Gemeindetisch, wie so viele andere auch.
Das Nomadenwerk hat inzwischen einen Alternativvorschlag erarbeitet. So sollen in Bozen drei Rastplätze errichtet werden und ein Platz für durchreisende Sinti-Gruppen. Eine Forderung, die von den zuständigen Behörden weder abgelehnt noch befürwortet worden ist. Ein Teil der Sinti hofft darauf. Sie wollen sich nicht mehr wegjagen lassen. "Mir sein von do", mit dieser Begründung besteht Natalina Ferrari auf ihrem Heimatrecht in Südtirol.
Vor der faschistischen Unterdrückungspolitik hieß die Sinti-Familie Ferrari noch Leitenberg. In der faschistischen Zeit wurden die deutschen und ladinischen Südtiroler zwangsitalienisiert. Auch viele Südtiroler Sinti mussten italienische Namen annehmen. Erst nach Einführung des Autonomiestatuts konnten die Südtiroler ihre angestammten Namen wieder annehmen. Andere Gruppen haben ihren deutschen Namen beibehalten können, wie die Adelsburg, Schöpf, Held, Endtner.
Natalina Ferrari lebt in einem Wohnwagen in der Genuastraße. Die alte Frau, mit 13 Jahren wurde sie in das provisorische KZ in der Reschenstraße gesteckt, will auch in Südtirol bleiben. Im Süden habe sie nichts verloren, mit italienischen Roma komme sie gar nicht aus. Wie die übrigen Bozner Sinti auch, die sich bewusst von den zugewanderten Sinti aus den Abruzzen absetzen. Im Sommer zog die rüstig wirkende Natalina in die Täler, erbettelte sich dort ihren Lebensunterhalt. Die Bauern hätten immer geholfen, erzählt sie, nie sei sie belästigt worden.
Natalina Ferrari wohnt mit ihren Enkeln zusammen. In einer brüchig gezimmerten Baracke leben fast zehn Menschen beisammen, in Dreck, zwischen Alteisen und Müll. Ganz anders schaut es bei den Gabriellis aus. Peinlich sauber, geordnet. Auch die Sinti-Gesellschaft kennt soziale Unterschiede. Und so unterschiedlich schauen die sieben Sinti-Plätze in Bozen auch aus. Einige gleichen den Elendsvierteln der Großstädte, andere haben Ähnlichkeiten mit Campingplätzen. Bisher lebten sie dort relativ in Ruhe, unter sich. Doch die Stadt dehnt sich aus, frisst sich in die letzten unbebauten Flecken hinein. Die Sinti in der Reschenstraße müssen den Volkswohnbauten weichen, die Handelszone im Süden der Stadt verdrängt die dort kampierenden Gruppen, in der Genuastraße rücken die Neubauten immer näher an die Wohnwagen der Sinti heran, und die wissen nicht, wohin. "Wohin soll man sich wenden, wenn man eh schon am Rande der Gesellschaft lebt?", fragt Gianfranco Gabrielli. Am Rande wollen sie sich nun festklammern und von dort aus um ihre Recht kämpfen. Auf einem internationalen Treffen der Zigeunerseelsorger 1978 auf der Lichtenburg in Nals meinte ein Sinti-Vertreter:
"Die Sinti brauchen zunächst einmal für sich Frei- und Lebensräume, um sich 'selbst zu leben', sie brauchen existentielle Sicherheit, um nicht unehrenhaft zu werden, werden zu müssen. Sie brauchen Anerkennung und Vermittlungshilfe, um selbst von äußeren Sorgen frei zu sein und wieder nach ihren alten Regeln leben zu können."
Aus: FF - Südtiroler Illustrierte
(18/85)
Dabei ist es gar nicht so lange her, dass im oberen Vinschgau noch Abkömmlinge von Karrner-Familien in den Dörfern lebten. So verstarb erst vor 15 Jahren der in weiten Teilen Südtirols bekannte und geschätzte Ross- und Obsthändler Alois Federspiel, ein Nachfahre einer großen Karrner-Sippe, wie ihn Alois Trenkwalder in seiner Geschichte "Vinschgauer Storchen" (Vom fahrenden Volk in vergangenen Zeiten, erschienen im Reimmichl-Kalender) beschreibt.
Bis zu 30 Prozent der Bevölkerung von Laatsch, Stilfs, Schleis und Planeil waren laut Trenkwalder im letzten Jahrhundert Karrner gewesen. Mit Früchte-, Käse-, Geschirr-, Essig-, Salz-, Glas-, Knochen- und Lumpenhandel verdienten die Karrner ihr hartes Brot. Im 16. Jahrhundert trieb die wirtschaftliche Not immer wieder Menschen aus ihren Dörfern und Tälern fort. Besonders verarmte Bauern und Tagelöhner aus dem oberen Vinschgau versuchten anderswo ihr Glück. Mit Kraxen trugen sie Waren von einem Dorf zum nächsten, wurden zu Wanderhändlern. Damals tauchte der Name Karrner auf.
"Karrner sind Karrenzieher, Wanderhändler, die auf Märkten mitgeführte Waren zum Kauf anboten, aber auch dort selbst Produkte erstanden, um sie andernorts zu verkaufen." (A. Trenkwalder). Im nördlichen Tirol wurde aus Karrner Lahninger, Dörcher und Grattenzieher. Die Sesshaften belegten vagabundierende Menschen, die Landfahrer, mit diesen Begriffen.
Um der enormen Zunahme der Karrner zuvorzukommen, erließen die Dorf- und Talgewaltigen Heiratsverbote. Half dies nichts, wurden die wehrfähigen Männer zur Karrnerjagd aufgerufen. Unter dem Vorwand der Hexenbekämpfung ließ 1675 der Erzbischof von Salzburg, Max Gandolf von Khuenberg, 180 Landstreicher vor Gericht stellen, "wo sie fast restlos zu einem möglichst grausamen Tod verurteilt wurden, Männer und Frauen bis zu hundert Jahren und Kinder bis zu drei Jahren herunter", schreibt Norbert Mantl in "Die Karrner", erschienen in den Heimatblättern des Tiroler Heimatpflegeverbandes.
Auch im 18. Jahrhundert weist die Chronik Karrnerverfolgungen auf. 15 bis 20 Mann machten sich auf Karrnerjagden, um das fahrende Volk zu vertreiben. Grund dieser Menschenjagd, so Mantl, sei gewesen, die "Heimatberechtigung durch Ersitzen" zu verhindern. Trotzdem überlebten die Karrner. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren Stilfs, Laatsch und Tartsch noch die Stammheimat der so genannten Vinschgauer Storchen gewesen. Geflochtene Körbe boten sie an, zogen mit Zeltwagen, Pferde-, Hunde- und auch Menschengespann durch den Vinschgau. Im Sommer kampierten die Landfahrer an Wassergräben. Bevorzugte Rastplätze waren der Prader Sand, die Eyrser Lahn, die Tscharser Weidenzone und die Rablander Lahn. Im Winter stellten die Heimatgemeinden dem fahrenden Volk Notunterkünfte zur Verfügung.
1935/36 war dann der große Wendepunkt. In Tartsch wurde damals die Staatsstraße erweitert. Die Karrner mussten weichen und wurden in einer Behelfsunterkunft untergebracht. Diese Karrner verließen 1939 als erste Südtiroler im Zuge der Option ihre Heimat. Zurück blieben jene Karrner, die ihre Identität aufgegeben hatten, zu anerkannten Bürgern aufgestiegen waren. Seitdem gibt es die Storchen nicht mehr.
Aus: FF - Südtiroler Illustrierte
(18/85)
Vor etwa eintausend Jahren kam es zu einem Exodus der meisten Angehörigen dieses Volkes aus ihrer Ursprungsregion in Indien und Pakistan. Sie siedelten sich in der Türkei, in Griechenland, in den osteuropäischen Ländern und in Mitteleuropa an. Die "Sinti", die aus der pakistanischen Provinz Sindh stammen, gelangten nach Deutschland und sind seit dem 14. Jahrhundert hier ansässig. Sinti, Roma und andere zugehörige Gruppen haben heute - ohne indische Fahrende wie die Banjara - etwa zwölf Millionen Angehörige. Die größten Gemeinschaften befinden sich mit jeweils 300.000 bis zu einer Million Roma in den osteuropäischen Ländern, in Rumänien nach Schätzungen sogar 1,5 bis drei Millionen. In Spanien leben die 400.000 bis 500.000 "Cale" (vgl. pogrom 194/ 1997, S.40 ff.), in der Bundesrepublik Deutschland etwa 60.-70.000 deutsche Sinti und etwa 40.000 deutsche Roma, die schon im vergangenen Jahrhundert und vor etwa 30 Jahren im Zuge der Gastarbeiteranwerbung aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen sind. Hinzu kommen weitere Zehntausende osteuropäische Roma, die sich derzeit in Deutschland um Asyl bewerben oder als Kriegsflüchtlinge aus Bosnien kamen.
In Osteuropa gerieten die Roma nach dem Zusammenbruch der kommunistischen und sozialistischen Systeme durchwegs in eine wirtschaftlich und sozial besonders schwierige Lage. Schon zuvor waren sie meist in einem Teufelskreis aus mangelnder Ausbildung, fehlenden Arbeitsmöglichkeiten, behördlicher Benachteiligung und ethnischer Diskriminierung gefangen, so verschlechterte sich ihre Situation Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in Rumänien, den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, in Bulgarien, Tschechien, der Slowakischen Republik, Polen und Ungarn rapide: Roma-Familien gerieten überwiegend unter die Armutsschwelle. Zum Teil - besonders in Rumänien zu Beginn der 90er Jahre - wurden sie sogar Opfer grausamer, ethnisch motivierter Übergriffe. In Ungarn sowie in der Tschechischen und der Slowakischen Republik kommt es seit Jahren immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen von Skinheads auf Roma. In Bulgarien sind Roma häufig Opfer polizeilicher Schikanen.
Seit Ende der 80er Jahre flohen viele Roma aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn und dem ehemaligen Jugoslawien nach Westeuropa, vor allem nach Deutschland. Hier wird von Menschenrechtsorgani-sationen immer wieder darauf hingewiesen, dass Deutsche eine besondere Verantwortung gegenüber den osteuropäischen Roma haben, von denen viele ebenso wie die deutschen Sinti und Roma Opfer der verheerenden Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus geworden sind. Hunderttausende Sinti und Roma sind in der Nazizeit ermordet worden oder an den Folgen unmenschlicher Behandlung in den Konzentrationslagern gestorben. Auch in Staaten Osteuropas hatten die überlebenden Roma schwer an den Folgen der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zu tragen.
In Bosnien-Herzegowina waren sie 1992-95 erneut genozidartigen Verbrechen ausgesetzt, begangen vom serbischen Regime unter Karadzic und Milosevic. Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme gründeten Roma in allen osteuropäischen Ländern, in denen sie starke Minderheiten stellen, innerhalb kurzer Zeit politische Parteien sowie demokratische, soziale und kulturelle Vereinigungen. In Rumänien, in der Tschechischen Republik, in der Slowakischen Republik sowie in Ungarn konnten Kandidaten der Roma in das Parlament einziehen. Der politische Einfluss der Roma ist allerdings in keinem der Länder Osteuropas angemessen. Eine gezielte, intensivere kulturelle und wirtschaftliche Förderung sowie Initiativen zum Abbau von Vorurteilen gegenüber Roma sind dringend nötig.
Der Europarat hat den Roma durch seine Minderheitenschutzkonvention zumindest theoretisch einen europaweiten Schutz verschafft. In den bisher 13 europäischen Ländern, in denen diese Konvention ratifiziert wurde, müssen Maßnahmen zur Förderung der Sprache und Kultur in Schulen und im öffentlichen Leben ergriffen werden. Diskriminierung und zwangsweise Assimilierung der Minderheiten sind verboten. Zu diesen Staaten gehören auch Rumänien, Ungarn, die Slowakei und Mazedonien. Die Tschechische Republik ist dem Abkommen zwar beigetreten, hat es aber noch nicht ratifiziert. Darüber hinaus gibt es die "Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen" (1991), die die Sprache der Roma, das Romanes, in der Kategorie der nicht an ein geographisches Gebiet gebundenen (non-territorialen) Sprachen zusammen mit Jiddisch aufführt.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hat in den 70er und frühen 80er Jahren ihre Aufgabe unter anderem darin gesehen, Sinti und Roma bei der Schaffung und Entwicklung ihrer Selbstorganisationen zu unterstützen und die andauernde Verfolgung durch Polizei und Gemeinden, sowie das Fortwirken rassenbiologisch orientierter "Zigeunerexperten" zu beenden. Die GfbV-Bürgerrechtsarbeit, darunter die Großkundgebung mit Sinti und Roma in der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen 1979 und der Welt-Roma-Kongress in Göttingen 1981, hat erstmals seit Ende des 2. Weltkriegs den NS-Genozid an den Sinti und Roma vor allem in Mitteleuropa zu einem weithin diskutierten Thema gemacht. Darüber hinaus wurden die Grundlagen nicht nur für die Wiedergutmachung, sondern auch für die Finanzierung der Sintiverbände, des Zentralrates deutscher Sinti und Roma und des Kulturzentrums der Sinti gelegt.
Inzwischen wird die Menschen- und Bürgerrechtsarbeit für Sinti und Roma in Deutschland weitgehend von den Organisationen der Sinti und Roma selbst geleistet, wobei sich der Zentralrat deutscher Sinti und Roma und andere Gruppen stärker auf die einheimischen Angehörigen dieser Minderheit konzentrierten. Im Laufe der 80er Jahre wurden Roma-Verbände gegründet, die sich schwerpunktmäßig für die Belange der ausländischen und staatenlosen Roma einsetzen und in den vergangenen zehn Jahren eine Reihe von großen, teilweise spektakulären Aktionen für ein Bleiberecht heimatloser Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien und für Roma-Flüchtlinge aus Rumänien durchführten. Die GfbV unterstützt diese Verbände und setzt Akzente durch eigene Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit bei besonders brisanten und aktuellen Themen.
Eines der wichtigsten Ziele ist die Lösung der Bleiberechtsprobleme heimatloser Roma-Flüchtlinge. Daneben muss alle Energie auf eine Verbesserung der Menschenrechtslage der Roma in den osteuropäischen Ländern gerichtet werden. Den westeuropäischen Ländern kommt die Aufgabe zu, die osteuropäischen Staaten wirtschaftlich zu unterstützen und gleichzeitig unter Druck zu setzen, eine wirksame Politik des Minderheitenschutzes zu betreiben.
Beitrag von Annelore
Hermes
Die Tragödie begann vordergründig am 1. März 1992, als bei einer von den Serben boykottierten Volksabstimmung 57 Prozent der Bewohner für die Unabhängigkeit votierten. Mitte April begann der Kampf um Sarajewo. Die Serben benutzten die Sorge um ihre Volksangehörigen als Vorwand für einen militärischen Generalangriff. Schon in den Monaten vor der Volksabstimmung hatte die serbische Armee starke Truppenverbände an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina konzentriert, die Militäraktion war also offenbar von langer Hand geplant.
Die Taktik war ebenso brutal wie erfolgreich: Zunächst rückten die Reste der Bundesarmee vor, schossen ein Dorf oder eine Region sturmreif und dann kamen die Freischärler (Tschetniks) oder Ortsansässige und erledigten die Drecksarbeit. Sie plünderten, brandschatzten, massakrierten, vergewaltigten und vertrieben diejenigen, die nicht rechtzeitig fliehen konnten. Dabei handelte es sich keineswegs um "sinnlosen Terror", wie es Cyrus Vance, der UN-Unterhändler, formulierte, sondern um gezielte Aktionen. Wenn die Grenzen neu gezogen würden, sollten in den von Serbien beanspruchten Gebieten nur noch Serben leben.
Die moslemische Landbevölkerung floh unter dem Terror in die größeren Städte wie Gorazde, Sbrenica oder Tuzla, die daraufhin von der serbischen Armee eingekesselt wurden. Die Blockade der Städte selbst für Hilfskonvois sowie der gleichzeitige Flüchtlingsstrom vollendeten die Katastrophe auch für diejenigen, die sich dem unmittelbaren Zugriff der serbischen Verbände entziehen konnten.
Etwa 1,5 Mio. Menschen wurden aus ihren Heimatorten vertrieben; 750000 von der serbischen Armee eingekesselt; Zehntausende starben an Hunger, Krankheiten und Kälte. Alle Vereinbarungen über einen Waffenstillstand wurden, zumeist von Serbien, immer wieder gebrochen. UN-Sanktionen, erstmals am 29. Mai 1992 gegen Serbien beschlossen, blieben weitgehend wirkungslos, weil niemand daran interessiert war, auf die Einhaltung ernstlich zu drängen.
Nach über einem Jahr brutaler Kriegführung schälten sich schließlich die Umrisse einer neuen Ordnung heraus. Das Land war dreigeteilt gemäß militärischer Eroberungen. Die Moslems besitzen noch knapp 20 Prozent des Territoriums in Zentralbosnien. Sie leben dort in einem Ghetto, ohne Zugang zum Meer, und der Platz reicht nicht einmal für alle Überlebenden.
Mit etwa 70 Prozent
fällt der größte Landanteil den Serben zu. Der
Serbenführer Milosevic betrachtete diese Aufteilung sogar
noch als Entgegenkommen für die Moslems. "Ihr Territorium
sei größer als das, was sie jemals militärisch
erobern könnten", höhnte er.
Die europäischen Großmächte beschlossen 1912, nach der endgültigen Vertreibung der osmanischen Despoten vom Balkan, die Aufteilung des albanischen Territoriums. Im Süden entstand ein unabhängiger Kleinstaat, das heutige Albanien; die mehrheitlich von Albanern besiedelte Provinz Kosovo im Nordosten wurde dem Herzogtum Serbien angeschlossen. Bis zur Besetzung des Balkan durch italienisch-deutsche Truppen 1941 behandelten die Serben die Albaner als Menschen zweiter Klasse und vertrieben viele ins südliche Albanien.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erstrebte Tito den Zusammenschluss Jugoslawiens, Albaniens und Bulgariens zu einer Balkanföderation. Die Pläne hätten eine Vereinigung des albanischen Territoriums beinhaltet. Doch Stalin und Albaniens Staatspräsident Enver Hodscha verhinderten dieses Vorhaben und besiegelten damit die Aufteilung des albanischen Volkes.
Ungeachtet der Verbesserungen für die Albaner blieb Kosovo jedoch das jugoslawische Armenhaus. Das mittlere Jahreseinkommen betrug nicht einmal die Hälfte des Landesdurchschnitts; die Arbeitslosigkeit lag über 25 Prozent. Deshalb forderten viele Albaner weitere Reformen, vor allem die Errichtung einer eigenen Republik, doch davon konnte nach Titos Tod keine Rede mehr sein. Schon vor der Eskalation des Bürgerkrieges wurden die Albaner Opfer des serbischen Chauvinismus. Als albanische Studenten im März und April 1981 in Pristina gegen die schlechten Studienbedingungen demonstrierten, schlug die Polizei die Kundgebungen gewaltsam nieder und verhaftete 500 Personen. Diese völlig unangemessene Brutalität führte zur Verbitterung und Solidarisierung breiter Bevölkerungsschichten mit den Inhaftierten, die schließlich zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen im gesamten Kosovo eskalierten. Um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, setzten die Sicherheitskräfte Panzerwagen ein und sperrten das Gebiet für alle Ausländer. Nach offizieller jugoslawischer Version fanden bei den Unruhen 11 Menschen den Tod; westliche Experten sprachen von 30 - 40 Opfern, Exilalbaner - vermutlich übertrieben - gar von mehreren Hundert.
In der Folgezeit wurden Hunderte Albaner - darunter viele Intellektuelle und Künstler - zu hohen Haftstrafen wegen "konterrevolutionären Aktivitäten" oder "staatsfeindlicher und nationalistischer Propaganda" verurteilt. Die Demonstration staatlicher Macht war jedoch nicht geeignet, die Region zu befrieden. Im Herbst 1988 trat der schwelende Konflikt wieder offen zu Tage. Um die Abwanderung der Serben und Montenegriner aus dem Kosovo zu stoppen, initiierten serbische Medien und Politiker eine Kampagne gegen die Albaner. Ihr Ziel war die Aufhebung der 1974 erlassenen Autonomie, die den Albanern in Wirtschaft, Verwaltung und Justiz weitgehende Eigenständigkeit gewähre. Hunderttausende Serben heizten unter der Obhut des damaligen KP-Vorsitzenden Slobodan Milosevic auf Demonstrationen und Kundgebungen die Stimmung gegen die Albaner an. Sie stürzten damit das gesamte föderalistische System in eine tiefe Krise, denn auch Slowenen und Kroaten beobachteten den wachsenden serbischen Nationalismus mit Argwohn. Deutliche Proteste aus den anderen Republiken blieben jedoch aus.
Im März 1989 löste die serbische Regierung den autonomen Status des Kosovo endgültig auf. Bei anschließenden Protesten starben mindestens 93 Albaner. Seit der Zeit herrschen die Serben im Kosovo mit Notstandsgesetzen, die jedwede Willkür rechtfertigen. Wer öffentlich albanische Musik hört, läuft bereits Gefahr, von den allgegenwärtigen serbischen Truppen schwer misshandelt zu werden. Albanische Schulen sind geschlossen, die Universität ist für Albaner nicht mehr zugänglich, und die Verwaltung liegt vollständig in serbischer Hand.
Slobodan Milosevic, Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien/Montenegro), lässt seine Truppen zum vierten Mal für "Großserbien" marschieren. Nach Slowenien (1991), Kroatien (1991) und Bosnien-Herzegowina (1992-1995) werden seit Februar 1998 im Kosovo albanische Ortschaften mit schweren Waffen beschossen und niedergebrannt, werden Zivilisten massakriert und vertrieben. Allen Beschwörungen zum Trotz, keine Wiederholung des Genozids in Bosnien zuzulassen, schaut Europa diesen Kriegsverbrechen seit sechs Monaten erneut tatenlos zu. Zehntausende hungernde Flüchtlinge haben sich in den Wäldern versteckt und hoffen bisher vergeblich auf Hilfe. Schon in sechs Wochen ist mit dem Wintereinbruch zu rechnen.
Von Anfang März bis Ende Juli 1998 haben serbische Truppen nach einer Statistik der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) mehr als 250 albanische Dörfer im gesamten Kosovo belagert, angegriffen oder zerstört. Schon vor Kriegsausbruch waren 300.000 Kosovo-Albaner vertrieben worden. Jetzt sind erneut weit über 300.000 Menschen, mehr als 15 Prozent der Bevölkerung des Kosovo, auf der Flucht. Mindestens 1.000 Menschen wurden getötet oder massakriert. Mindestens 400 Kosovo-Albaner sind spurlos verschwunden. Unter den Toten sind auch Männer, die als Asylsuchende in Deutschland abgewiesen und in den Tod zurückgeschickt wurden.
Die Strategie der Angriffe, Massaker und Vertreibungen weist deutliche Parallelen zum Bosnienkrieg auf. Auch die Täter sind dieselben. Im Kosovo sind neben der jugoslawischen Armee und Sondereinheiten der serbischen Polizei auch paramilitärische "Tschetnik"-Truppen unter Führung der berüchtigten mutmaßlichen Kriegsverbrecher Zeljko Raznjatovic "Arkan" und Vojislav Seselj im Einsatz. Ihr "oberster Dienstherr" ist Slobodan Milosevic.
Der Krieg im Kosovo
ist keine "innere Angelegenheit" Jugoslawiens, in die man sich,
so die Schutzbehauptung zahlreicher europäischer Politiker,
nicht einmischen dürfe. Im ehemaligen Jugoslawien unter Tito
war Kosovo "Autonome Provinz" und politisch den heute
selbständigen ehemaligen Teilrepubliken des damaligen
Jugoslawien defacto gleichgestellt. Gegen den heftigen Widerstand
der Kosovo-Albaner, die mehr als 90 Prozent der Bevölkerung
ausmachen, hob Milosevic kurz nach seinem Amtsantritt diese
Autonomie 1989 auf. Er begann mit einer aggressiven Serbisierung,
die in den derzeitigen Massenvertreibungen ihren traurigen
Höhepunkt erlebt. Bis zum Beginn der serbischen Angriffe
leisteten die Kosovo-Albaner neun Jahre lang friedlich und
gewaltfrei Widerstand. Niemand hat sie dabei unterstützt.
Statt dessen erkannten die Staaten der Bosnien-Kontaktgruppe -
bis auf die USA - die heutige Bundesrepublik Jugoslawien an, ohne
über das Selbstbestimmungsrecht der Kosovo-Albaner auch nur
zu verhandeln. So haben sie sich an der Tragödie dieses
Volkes mitschuldig gemacht.
Vor der Vertreibung stellten die Serben in der kroatischen Krajina die Mehrheit der Bevölkerung. Diese an Bosnien-Herzegowina angrenzende Region war von 1991 bis 1995 von den Statthaltern des serbischen Milosevic-Regimes beherrscht. Dann eroberte die kroatische Armee die Krajina zurück. Die kroatische Regierung behauptet zwar, die Vertriebenen dürften zurückkehren. Doch dies behindern kroatische Behörden vor Ort mit allen Mitteln. Morddrohungen und -anschläge gegen die wenigen Rückkehrer sind an der Tagesordnung. Die kroatische Polizei schützt sie so gut wie nie. Zurzeit verlassen serbische Staatsbürger Kroatien noch immer mehr als zurückkehren. Heute sind nur noch fünf Prozent der Einwohner Kroatiens Serben, 1990 waren es zwölf Prozent.
Auch die Rechte der zweitgrößten Minderheit im Land, der Muslime, wurden eingeschränkt. Sie waren in der Verfassung ausdrücklich als Minderheit anerkannt worden, dieser Passus wurde aber gestrichen. Die italienische Volksgruppe auf der Halbinsel Istrien wird diskriminiert, Übergriffe gegen Roma werden toleriert.
Die serbische Aggression gegen Kroatien
Im Juli 1991 wurde Kroatien von der serbisch dominierten Jugoslawischen Volksarmee (JNA) angegriffen. Ostslawonien mit der Barockstadt Vukovar wurde zu großen Teilen in Schutt und Asche gelegt. Auch Teile Westslawoniens und die Krajina wurden von der JNA okkupiert. Unterstützt wurden die Truppen von größeren Teilen der dort ansässigen serbischen Bevölkerung. Die meisten Kroaten und viele andere Nichtserben wurden vertrieben, ermordet und misshandelt. Über 10.000 Kroaten wurden ermordet oder sind bis heute vermisst.
Durch pausenloses Bombardement ziviler Ziele wurden etwa 500 kroatische Dörfer und Städte, 370 katholische Kirchen und Kapellen, 440 Klöster, vier jüdische Synagogen und 470 registrierte Kulturdenkmale sowie zahlreiche Friedhöfe zerstört. Auch Dubrovnik lag monatelang unter Dauerbeschuss, konnte jedoch standhalten. Während dieser serbischen Aggression gegen sein eigenes Land verhandelte der kroatische Präsident Franjo Tudjman mit seinem "Kollegen", dem heutigen serbischen Präsidenten der neuen Bundesrepublik Jugoslawien, Slobodan Milosevic, über die Teilung Bosnien-Herzegowinas.
Kroatiens Krieg gegen Bosnien
In Bosnien trieb der Präsident Kroatiens Tudjman einen Keil zwischen die dort lebenden Kroaten und die muslimischen Bosnier. Im Oktober 1992 ließ er den demokratisch gewählten Vertreter der bosnischen Kroaten, Stjepan Kljuic, stürzen. Im Mai 1993 griff die Armee Kroatiens unterstützt von extremistischen bosnischen Kroaten Restbosnien an. In dem an Kroatien angrenzenden Teil Bosniens, in dem die Kroaten in vielen Gemeinden die Mehrheit bildeten, wurde mit der Vertreibung der Muslime begonnen. In diesem so genannten "Herceg Bosna" wurden über 15.000 Muslime in Konzentrationslager gesperrt, gefoltert und Hunderte von ihnen ermordet. Auch in Dörfern und Städten gab es Massaker an unschuldigen Zivilisten. Moscheen wurden systematisch zerstört, traditionelle osmanische Altstädte verwüstet.
Die kroatischen Behörden in der "Herceg Bosna" wollen diese Region Bosnien-Herzegowinas als "rein kroatisches" Gebiet regieren. Sie versuchen, die Rückkehr der geflüchteten und vertriebenen bosnisch-muslimischen und bosnisch-serbischen Bevölkerung zu verhindern. Nur internationalem Druck ist es zu verdanken, dass trotzdem Tausende zurückkehren konnten. Heute ist "Herceg Bosna" Teil der Kroatisch-Bosniakischen Föderation, die neben dem serbisch kontrollierten Gebiet, der so genannten "Repulika Srpska", einen der beiden Teilstaaten Bosniens bildet.
Offensive "Sturm": Kroatische Truppen vertreiben 200.000 Serben
Mit der Offensive "Sturm" eroberten kroatische Truppen zwischen dem 4. und 8. August 1995 die kroatische Krajina zurück. Sie schlugen die serbischen Einheiten in die Flucht, die dieses Gebiet seit 1991 okkupiert hatten. Innerhalb dieser vier Tage flüchtete die überwältigende Mehrheit der in der Krajina ansässigen serbischen Bevölkerung, insgesamt etwa 200.000 Menschen, in die benachbarten serbisch besetzten Regionen Westbosniens. Nur rund 9.000 Serben - überwiegend alte und kranke Menschen - blieben zurück. Einheiten der kroatischen Armee und Polizei begingen während und nach der Offensive zahlreiche Verbrechen an nicht geflüchteten serbischen Staatsbürgern Kroatiens. Bis zu 2.000 Menschen sollen ermordet und zum Teil in Massengräbern verscharrt worden sein.
Kroatiens Apartheidpolitik: Keine Rückkehr für Krajina-Serben
Nach ihrer
panischen Flucht aus der Krajina wurden die rund 200.000
serbischen Staatsbürger Kroatiens im serbisch kontrollierten
Teil Bosniens, in der Wojwodina, Altserbien und im Kosovo
verteilt. Zehntausende von ihnen versuchten immer wieder, in ihre
zerstörte Heimat zurückzukehren. Allein das
unabhängige serbische Helsinki Komitee registrierte
über 50.000 rückkehrwillige serbische Flüchtlinge
aus Kroatien. Das Tudjman-Regime will die
Bevölkerungsstruktur der Krajina durch die Ansiedlung
geflüchteter bosnischer Kroaten, aber auch albanischer
Katholiken aus dem Kosovo für immer verändern. Zwar
wurden Gesetze und Verordnungen erlassen, nach denen die
Vertriebenen zurückkehren dürfen. Doch vor Ort
stoßen sie auf meist unüberwindbare Hindernisse. Kaum
jemand erhält sein Haus oder seine Wohnung zurück.
Serbische Rückkehrer werden bedroht, durch
Bombenanschläge verletzt oder getötet. Die Polizei
ermittelt nicht, Behörden verweigern Integrationshilfe.
Mitten in Europa praktiziert Kroatiens Regime eine Politik der
Apartheid nach südafrikanischem Vorbild.
Dieser Vorwurf wird vom serbischen Regime einzig und allein gegen politisch aktive Vertreter der ethnischen Minderheiten erhoben, um diese einzuschüchtern und zu kriminalisieren. Damit sind acht Monate relativer Ruhe im Sandschak-Gebiet vorüber. In den Wahlen vom 3.11.1996 hatte eine gemeinsame Liste der muslimischen Parteien im Sandschak in der regionalen Hauptstadt Novi Pazar (74.000 Einwohner), sowie in Sjenica (35.570) und Tutin (32.779) die Stimmenmehrheit erlangt und auch im Föderalparlament einen Sitz gewonnen. Diese Erfolge gaben Hoffnung auf mehr Toleranz und eine Verbesserung der Menschenrechtssituation für die muslimische Minderheit in Serbien-Montenegro. Nun leben die Menschen im Sandschak wieder wie im Ausnahmezustand und befürchten neue Verfolgungen und Rechtlosigkeit. Nach einem Bericht des Helsinki-Komitees von Sandschak überwachen Sondereinheiten der Polizei die Zugänge nach Novi Pazar und sogar die staatlichen Betriebe. Wer die Stadt verlassen will, wird kontrolliert. Das Helsinki-Komitee des Sandschaks berichtet: "Die Menschen sind verängstigt und deprimiert."
Rund 440.000
Menschen leben im Sandschak, der etwa halb so groß ist wie
Thüringen, 250.000 davon in Serbien, 190.000 in Montenegro.
Von ihnen sind nach unterschiedlichen Angaben zwischen 226.600
oder 51,5% (nach Angaben der serbischen Regierung) und 330.000
oder 75% (nach Angaben der Moslem-Partei SDA) muslimischer
Nationalität. Seit 1992 - während des Krieges in
Bosnien-Herzegowina - gingen serbische Truppen auch im
unmittelbar angrenzenden Sandschak-Gebiet gegen die muslimische
Bevölkerung vor. Serbische Extremisten und
paramilitärische Verbände aus Serbien und aus Bosnien
benutzten den Sandschak als Hinterland und terrorisierten die
einheimische Bevölkerung, teilweise mit Beteiligung der
serbischen Polizei und Armee. Bis zu 80.000 Muslime (nach Angaben
der UN-Sonderberichterstatterin Elisabeth Rehn) flohen in andere
Landesteile oder ins Ausland. Aus den Dörfern im
unmittelbaren Grenzgebiet in der Umgebung von Sjeverin und
Bukovica wurden bis zu 5.000 Muslime mit Gewalt vertrieben,
häufig wurden die zurückgelassenen Häuser
geplündert und dann angezündet oder vermint, damit die
Geflohenen nicht wieder zurückkehren
konnten.
Kurden in der Türkei
Die starre Haltung aller bisheriger Regierungen in der Türkei hat zu einem starken Assimilationsdruck und zu heftigen Aufständen der Kurden geführt. Die Worte Kurde und Kurdistan wurden aus allen Schulbüchern, Lexika und Landkarten getilgt oder gelten nur noch für die Kurden in den Nachbarstaaten. Die öffentliche Verwendung der Sprache ist verboten, ebenso sind dies kurdische Kulturvereine und politische Parteien. Kurdische Schulen wurden nicht zugelassen. Kurdische Zeitungen, Zeitschriften und Bücher werden immer wieder beschlagnahmt oder verboten, Verlage geschlossen. Kurdische Familien- und Ortsnamen wurden turkifiziert. 1934 wurde ein Gesetz erlassen, das die Zwangsumsiedlung solcher Bevölkerungsgruppen, die nicht mit der nationalen Kultur verbunden sind, rechtfertigt.
Seit 1979 werden regelmäßige Razzien des Militärs in den kurdischen Dörfern durchgeführt, seit August 1984 führt die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), in der Bundesrepublik mittlerweile verboten, einen Guerillakrieg gegen militärische und zivile staatliche Einrichtungen, aber auch gegen Kurden, die der Zusammenarbeit mit dem Staat bezichtigt werden. Dieser Aufstand wird von der türkischen Regierung nicht mit politischen Mitteln unter Einbeziehung der politisch arbeitenden kurdischen Opposition geführt, sondern mit brutalem militärischem Einsatz, der keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nimmt. Dem Bericht einer Untersuchungskommission des türkischen Parlamentes von 1998 zufolge wurden insgesamt 3.428 Dörfer zerstört und drei Millionen Kurden zu Flüchtlingen gemacht. Allein das kurdische Siedlungszentrum in der Türkei Diyarbakir nahm ca. eine Million Flüchtlinge auf. 5.500 Zivilisten wurden in diesem brutalen Krieg getötet, 17.000 verletzt. 2.200 von 5.000 Schulen und 740 von 850 Gesundheitsstationen wurden geschlossen. Hinzu kamen Maßnahmen des Staates wie Weideverbot und Verminung der Almwege. Die Politik im Staat wird faktisch vom Nationalen Sicherheitsrat diktiert, der zu einer Art Staat im Staat geworden ist.
Die Zivilbevölkerung ist dem Druck der auf Zusammenarbeit drängenden radikalen Guerilla und der mit Ausnahmerechten ausgestatteten türkischen Behörden und Militärs ausgesetzt. Sie steht zwischen den Fronten. Hunderte sitzen wegen Unterstützung der PKK oder wegen des bloßen Verdachts darauf im Gefängnis. Im Februar 1994 wurden gewählte kurdische Parlamentarier der DEP-Partei (Leyla Zana u.a.) inhaftiert, kurdische Parteimitglieder und Journalisten wurden und werden verfolgt, gefoltert oder von unbekannten Tätern ermordet. 1998 wurde auch die Führungsspitze ihrer Nachfolgepartei HADEP, sowie etliche ihrer Funktionäre, verhaftet.
Kurden im Iran
Auch im Iran müssen die Kurden, die zur iranischen Sprachgruppe gehören, um ihre kulturelle Autonomie kämpfen, auch dort gelten sie "nur" als Iraner. Obwohl der kulturelle und sprachliche Unterschied im Iran nicht so gegensätzlich ist wie zwischen dem türkischen (Turksprache) und arabischen (semitische Sprachgruppe) Kulturkreis, resultiert der Konflikt auch in diesem Land nicht nur aus dem Unabhängigkeitsstreben der Kurden gegen den staatlichen Zentralismus und die Unterdrückung der kurdischen Sprache. Er ergibt sich auch aus dem beträchtlichen religiösen Gegensatz zwischen den schiitischen Iranern und den sunnitischen Kurden. Dieser Gegensatz spielt besonders unter dem Mollahregime, von dem sich die Kurden anfangs sogar Autonomie versprochen hatten, eine große Rolle.
Im August 1979 verkündete Khomeini den Heiligen Krieg gegen die Kurden. Kurdistan wurde zum militarisierten Sperrgebiet, zu dem weder Journalisten noch ausländische Delegationen Zutritt haben. Die sunnitischen Moscheen wurden zerstört und die Jugendlichen in den Schulen umerzogen. Die kurdische Opposition ging in den Untergrund; immer wieder werden iranische Kurdenführer auch im Ausland Opfer von Mordanschlägen des iranischen Staatsterrorismus.
Kurden in Syrien
Die Kurden bilden mit schätzungsweise einer Million Angehörigen etwa 10 Prozent der Bevölkerung Syriens. Während sie bis Ende der 50er Jahre kulturelle Freiheiten genossen, begann um 1962 mit dem Erstarken der panarabischen Ideologie und 1963 mit der Machtübernahme der panarabischen Baath-Partei, die eine ethnische und kulturelle Eigenständigkeit von Minderheiten leugnet, eine restriktive Kurdenpolitik. Sie fand ihren Ausdruck in einer Sondervolkszählung, bei der schon 1962 fast 120.000 Kurden zu Ausländern erklärt und damit aller Bürgerrechte beraubt wurden. Die Zahl der ausgebürgerten Kurden liegt heute bei etwa 200.000. Sie können keinen Pass beantragen, ihre Kinder nicht registrieren und einschulen lassen, nicht legal heiraten, bekommen keine Anstellung im Staatsdienst.
Ebenfalls auf Beginn der 60er Jahre geht die Politik des Arabischen Gürtels zurück, die entlang der Grenze zur Türkei einen 15 km tief in syrisches Gebiet hineinreichenden Streifen Land schaffen wollte, aus dem die ansässigen Kurden aus- und regimetreue arabische Wehrbauern angesiedelt werden sollten. Präsident Assad erklärte das Projekt 1976 offiziell als beendet. Es wird jedoch heimlich fortgesetzt. Mittlerweile werden in Syrien kurdische Dorf-, Berg- und Flussnamen durch arabsiche ersetzt.
Auch die Kurden, die eine Staatsangehörigkeit besitzen, genießen keine autonomen kulturellen Rechte. Allerdings werden viele von ihnen stark in das staatliche Leben einbezogen, vielfach sogar in privilegierten Stellungen eingesetzt, um den Präsidenten, der einer religiösen Minderheit angehört, zu unterstützen. Syrien ist immer wieder Zufluchtsland für kurdische Partisanenführer aus den Nachbarländern Irak und Türkei gewesen.
Auch der Generalsekretär der PKK führte seine Operationen von Syrien aus. Dabei ging es jedoch nicht um eine wirkliche Unterstützung kurdischer Rechte, sondern wohl eher um das politische Kalkül Syriens gegenüber den Regierungen der Nachbarstaaten. Als im Herbst 1998 die Türkei Syrien mit Krieg drohte, wenn es seine Unterstützung für die PKK nicht einstellt, floh Öcalan ins Ausland. Syrien erklärte, dass die PKK-Lager im Libanon und in Syrien geschlossen werden. Am 12. November 1998 wurde PKK-Chef Öcalan bei der Einreise nach Italien in Rom verhaftet, worauf er einen Asylantrag stellte. Nach einer Presseschlacht wurde er aber schließlich in die Türkei überstellt, wo er zum Tode verurteilt wurde.
Kurden im Irak
Der Irak war der erste Staat mit einer beträchtlichen kurdischen Minderheit, der in einem Verfassungsdokument 1958 die nationalen Rechte der kurdischen Bevölkerung anerkannte: Dieser Nation gehören Araber und Kurden an, die Verfassung garantiert ihre nationalen Rechte im Rahmen des irakischen Gemeinwesens. Diese Rechte standen jedoch nur auf dem Papier. 1970 kam es mit den 1968 an die Macht gekommenen sozialistischen Baathisten zu einem Abkommen, das eine Autonomie nach einer Übergangszeit von vier Jahren vorsah. Umgesetzt wurde es nicht. Gegen die Kurden wurde eine Politik der Umsiedlung und Vertreibung, der Bombardements und Arabisierung durchgeführt, die Widerstandskämpfe und eine Massenflucht von Kurden in den Iran zur Folge hatte.
In den 80er Jahren wurde ein beispielloser Vernichtungsfeldzug gegen die Kurden geführt. 1988 - während des 1.Golfkrieges - wurde die kurdische Stadt Halabja mit Giftgas bombardiert. Mehr als 5000 Frauen und Kinder starben damals qualvoll an den Folgen des Giftgases. Tausende erduldeten unter dem Baathregime des Präsidenten Saddam Hussein Folter, Hunger, Gefangenschaft, Deportation und Massenbegräbnisse bei lebendigem Leibe. Insgesamt wurden 4500 Dörfer, rund 90 Prozent der ländlichen Region, völlig zerstört und dem Volk damit die materielle und kulturell-soziale Lebensgrundlage geraubt.
Nach der Befreiung durch die Alliierten des Golfkrieges wurde für Irakisch Kurdistan durch die UNO-Resolution 688 eine Schutzzone nördlich des 36. Breitengrades eingerichtet. Sie soll die Menschen vor den Überfällen des irakischen Präsidenten Saddam Hussein schützen. Bis heute (Stand: November 1998) existiert die Schutzzone, die alle sechs Monate erneut bestätigt werden muss, weiter. Sie bietet die einzige Chance für die dort lebenden Kurden, ihre Dörfer und Äcker wieder nutzbar zu machen und eine eigene Verwaltung aufzubauen.
Im Mai 1992 konnten unter dem Schutz der Alliierten in Irakisch-Kurdistan die ersten freien Wahlen stattfinden. Die beiden großen Parteien, der Wahlsieger Demokratische Partei Kurdistans KDP und die Patriotische Union Kurdistans PUK, einigten sich auf ein Patt (50:50), die KDP trat außerdem Sitze an die Kommunisten, die Assyrer und die Islamisten ab.
Gegenseitige
Vorwürfe führten dann im Dezember 1993 zum
Zerwürfnis zwischen KDP und PUK, das in der Besetzung des
Parlaments durch Peshmargas der PUK gipfelte. Dies führte zu
bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, die im
Frühjahr 1994 eskalierten und zu einer Zweiteilung des
Nordirak führten (Nordwesten: KDP, Südosten: PUK). Im
Sommer 1995 meldete auch die PKK Ansprüche im Nordirak an;
sie stellte sich an die Seite der PUK und gegen die KDP. Nach
einem Waffenstillstand (und auf Druck der USA) unterzeichneten
die beiden Parteien 1998 einen Friedensvertrag. Neue Wahlen
wurden vorgesehen, die das bisher gespannte Verhältnis
zwischen beiden Parteien entkrampfen sollten.
Bis 1915 lebten rund eine Million Assyrer in einem Dreieck, das sich nach jeder Seite etwa 300 km ausdehnt. Westlichster Ausläufer ist das Bergland des Tur Abdin (westlich davon die Städte Mardin und Diyarbakir) in der Südosttürkei. Nach Süden und Südosten wird das Gebiet durch Siedlungen in der nordsyrischen Ebene nahe der türkischen Grenze und in der Mosul-Ebene begrenzt, im Nordosten durch das Hakkari-Gebirge (Osttürkei, ehemaliges Hauptsiedlungsgebiet der Angehörigen der Alten Apostolischen Kirche des Ostens).
Während des Ersten Weltkrieges waren nicht nur die christlichen Armenier, sondern auch die Angehörigen der syrischen Kirchen Opfer grausamer Verfolgung und Vertreibung. Die Assyrer verloren in den nördlichsten Gebieten Obermesopotamiens und im Iran über 50 Prozent ihrer Gesamtbevölkerung. Bis auf spärliche Reste wurden sie aus ihren alten Siedlungsgebieten vertrieben und mussten unter schwierigsten Bedingungen jahrelang in Lagern leben, die unter Aufsicht des Völkerbundes standen. Bei der Gründung der jungen Nationalstaaten Irak, Syrien und der modernen Türkei wurde das Verlangen der Assyrer nach Selbstbestimmung und Autonomie nicht berücksichtigt. Trotz internationaler Versprechungen konnten sie nicht in ihre alten Wohngebiete zurückkehren. Mit dem Vertrag von Lausanne 1923, der endgültigen Grenzziehung und der Regelung der sogenannten Mosul-Frage im Jahre 1925, war ihr Schicksal besiegelt: Es blieb ihnen keine andere Wahl, als zu den Angehörigen ihres Volkes in den verschiedenen neuen Staaten des Nahen Ostens zu fliehen.
Die letzten zwanzig Jahre stellen für die Assyrer im Nahen Osten einen der grausamsten Abschnitte ihrer Geschichte nach den Genozid-Verbrechen von 1914 bis 1922 dar.
In der Türkei geraten die Assyrer seit 1984 zunehmend zwischen die Fronten des erbittert geführten Krieges des türkischen Militärs gegen die Anhänger der radikalen kurdischen Arbeiterpartei (PKK). Assyrer werden sowohl von der PKK als auch von den türkischen Regierungstruppen, von Spezialeinheiten und der Polizei sowie von islamisch-fundamentalistischen Kräften und von kurdischen Agas in unterschiedlicher Intensität bedrängt und unter Druck gesetzt. Unter solch ständiger Bedrohung verließen in den letzten zehn Jahren mehrere Zehntausend Assyrer ihre türkische Heimat. Heute leben nur noch höchstens 12.000 Assyrer in der Türkei, etwa 500 Familien im Tur Abdin und wenige Tausend in Istanbul.
Im Irak bilden die Assyrer mit mehr als einer Million Menschen nach den Arabern und Kurden die drittstärkste Bevölkerungsgruppe. Nach dem Machtantritt der Baath-Partei unter Saddam Hussein (1968) begann für sie eine besondere Leidenszeit: Immer wieder wurden größere Gruppen verhaftet und Menschen hingerichtet. Zahlreiche assyrische Intellektuelle "verschwanden" - über ihr Schicksal herrscht zum Teil bis heute Ungewissheit. Systematisch wurden unter Saddam Hussein etwa 200 assyrische Dörfer von der Armee zerstört. 150 Kirchen und Klöster wurden dem Erdboden gleichgemacht. Viele Assyrer wurden, wie die Kurden, in sog. "Modelldörfer" deportiert, die Internierungslagern gleichen.
Der 1. Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak forderte bereits etliche Menschenleben in der assyrischen Bevölkerung. Etwa 40.000 Assyrer wurden Opfer von Genozid. Zu ihnen gehören auch 2.000 assyrische Opfer der Giftgasangriffe, die das Saddam-Regime 1988 gegen Siedlungen und Städte der Kurden und Assyrer im Nordirak (Halabdja) durchführte. Unter den Flüchtlingen aus dem Nordirak, die im Frühjahr 1991 nach dem 2. Golfkrieg in die Nachbarstaaten Türkei und Iran flohen, befanden sich auch Zehntausende Assyrer. Nachdem die Allliierten nördlich des 36. Breitengrades im Nordirak eine Schutzzone eingerichtet hatten, entschloss sich die Mehrzahl dieser Flüchtlinge, in ihre zerstörten Dörfer zurückzukehren. Unter dem Schutz der Alliierten konnte sich Irakisch-Kurdistan zu einem autonomen, selbstverwalteten Föderalstaat entwickeln.
Aber Kurden und
Assyrer konnten bis heute nicht gleichberechtigt zusammenleben.
Der Konflikt zwischen den beiden großen Kurdenparteien, die
Besetzung assyrischer Dörfer durch Kurden und Anschläge
auf assyrische Politiker haben viele Hoffnungen zunichte gemacht.
Ohnehin schwebt die Bedrohung durch das Baath-Regime Saddam
Husseins wie ein Damoklesschwert über dem Nordirak, dessen
Wohl und Wehe nach wie vor von der Existenz der alliierten
Schutzzone abhängig ist.
Yezidi - in alle Welt verstreut
Seit jeher sind Yezidi Bauern und Viehzüchter. Yeziden und nationalistische Kurden geben an, dass bis zu ihrer Zwangsislamisierung im 9. bis 11. Jahrhundert die Mehrzahl der Kurden der yezidischen Religion zugehörig gewesen sein soll. Weltweit sollen sich heute noch mindestens 150 000 Menschen zum yezidischen Glauben bekennen. Genaue Zahlen gibt es jedoch nicht, denn in keinem der Staaten, in denen Yezidi leben (Türkei, Iran, Irak, Syrien, GUS, Bundesrepublik Deutschland) sind sie statistisch erfasst. Besonders weit klaffen die Schätzungen von Experten für den Irak (50.000 bis weit über 100.000) und für die Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) auseinander (30.000 bis über 40.000). Während des Ersten Weltkrieges waren zwischen 24.000 und 35.000 Yezidi aus dem Osmanischen Reich nach Transkaukasien (heute: Armenien und die Nachbarrepubliken) geflohen. In der Türkei leben vermutlich nur mehr einige hundert, in Syrien etwa 5.000 bis 10.000 und im Iran ebenfalls nur wenige tausend Yezidi. Mehr als 10.000 Yezidi aus der Türkei leben heute in Deutschland.
Der Nordirak: Zentrum der Yezidi
Der irakische Diktator Saddam Hussein ließ in den 70er Jahren fast ein Drittel der yezidischen Bevölkerung in den Süden des Landes deportieren. Nordöstlich von Mosul, in der Umgebung ihres religiösen Zentrums in Scheych Adi und in dem Gebiet um Baadri, dem Wohnort ihres weltlichen Oberhauptes, des Mirs, durften die Yezidi bleiben. Als die irakische Armee von 1986 bis 1988 gegen die für ihre Freiheit kämpfenden Kurden vorging, bombardierte sie auch yezidische Dörfer mit Giftgas. Die Überlebenden, denen die Flucht nicht gelang, wurden in den Provinzen Niniveh und Arbil in Lagern interniert oder ebenfalls in den Süden des Landes zwangsumgesiedelt. Im Frühjahr 1992, nach Beendigung des zweiten Golfkrieges, flüchteten viele Yezidi während des kurdischen Aufstandes aus den von den irakischen Truppen kontrollierten Gebieten in das von den Alliierten geschützte "Freie Kurdistan Nordirak."
In der Türkei verfolgt und vertrieben
Anders ist es in der Türkei. Die Yezidi werden dort wegen ihres Glaubens von ihren muslimischen Nachbarn gehasst und verachtet. Weil Yezidi den Kurden zugerechnet werden, sind auch sie der Diskriminierung und Verfolgung türkischer Behörden und Bürger ausgesetzt. Weil ihre Religion nicht als Buchreligion anerkannt ist, wird auch ihr Glaube rücksichtslos bekämpft: Es gilt das islamische Gesetz des Glaubenskrieges. Die Yezidi sollen mit allen Mitteln zwangsbekehrt werden. Deshalb werden sie ebenfalls von den muslimischen Kurden bedrängt.
Seit 1937 ist in der Türkei die Trennung von Kirche und Staat (Laizismus) in der Verfassung verankert. Doch der für alle Kinder obligatorische Ethikunterricht an den türkischen Schulen ist faktisch eine Unterweisung in den Islam. Die Lehrer sind ausschließlich Muslime. Alle Schüler, egal welcher Religionsgruppe sie angehören, müssen das islamische Glaubensbekenntnis auswendig aufsagen können. Für yezidische Kinder ist dies jedoch eine Todsünde. Während des Militärdienstes oder bei der gemeinsamen Arbeit mit Muslimen muss ein Yezidi ständig Tabus brechen, um nicht als "Ungläubiger" erkannt und bestraft zu werden.
Binnenfluchtalternative gibt es nicht
Yezidische Gemeinschaften haben in türkischen Großstädten keine Überlebenschancen. Eine Binnenfluchtalternative, die von deutschen Behörden und Gerichten lange Zeit unterstellt wurde, haben sie nicht. In den Großstädten wären sie gezwungen, ihre Religion aufzugeben, zu der sie sich nicht offen bekennen können. Die zentrale Glaubensbedingung, eine Gemeinschaft von mindestens neun Gläubigen zu bilden, könnten sie nicht unbemerkt erfüllen. Außerdem ist das Leben in der Großstadt für die Yezidi unvereinbar mit ihren jahrhundertealten Begräbnisbräuchen. Die muslimisch-türkischen Behörden in Istanbul würden den Verehrern des Teufels niemals die Genehmigung für die Einrichtung eines Friedhofes erteilen. In absehbarer Zeit wird es die alten Yezidi-Friedhöfe im Südosten der Türkei nicht mehr geben. Sie werden von aufgebrachten Muslimen zerstört oder einfach umgepflügt. Jeder Yezide, der in einer türkischen Großstadt auf Arbeitssuche geht, muss mit Diskriminierung rechnen. Ein Hinweis in seinem Pass verrät seine Religion.
Flucht nach Deutschland
Aus Angst um ihr Leben sind in den letzten Jahren Tausende von Yezidi vor den türkischen Behörden und den Milizen kurdisch-muslimischer Großgrundbesitzer ins Ausland geflohen. Ihr dramatischer Exodus ist beinahe abgeschlossen. Die meisten Yezidi fanden Aufnahme in der Bundesrepublik. Zwei Urteile des Bundesverfassungsgerichts von 1989 und 1991 ermöglichten ihnen das Bleiberecht. Noch im gleichen Jahr führten die Innenminister der Länder eine Stichtagslösung ein. Diejenigen Yezidi, die vor dem 31. 12. 1988 eingereist sind, dürfen grundsätzlich in Deutschland bleiben.
Die meisten der in
Deutschland lebenden Yezidi wohnen in Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen. Ihr Aufenthaltsstatus ist großenteils
gesichert. Auch die wenigen noch in der Türkei verbliebenen
Yezidi möchten ihren Verwandten nachfolgen, denn dort kommt
es immer wieder zu Übergriffen auf Yezidi, die auch
Todesopfer fordern. Aber der Fluchtweg zu ihren Familien in der
Bundesrepublik ist für die meisten schwierig, da sie nicht
die nötigen finanziellen Mittel haben, um sich Visa und
Flugtickets zu beschaffen. Letztlich bleibt den Betroffenen aber
nur die Ausreise, denn ein Überleben in der
Südosttürkei ist ihnen und ihrer Religion nicht
möglich.
In Marokko stellen Masiren mehr als 50 Prozent der Bevölkerung
Die Zahl Menschen mit Masirisch als Muttersprache wird auf 20 bis 25 Millionen geschätzt. Die Regierungen Nordafrikas geben allerdings niedrigere Zahlen an. Den größten Anteil an der Gesamtbevölkerung haben die Masiren in Marokko, nämlich mehr als 50 Prozent. In Algerien stellen sie 25 bis 30 Prozent. Auch die Tuareg, die in den Wüsten von Südalgerien, Südlibyen, Mali, Niger und Burkina Faso leben, sind Masiren. Sprachwissenschaftler sind sich uneinig, zu welcher Sprachgruppe das Masirische zählt. Manche sagen, es sei eine "afroasiatische" oder hamito-semitische Sprache, andere halten es für eine indoeuropäische wie z.B. das Griechische. Wieder andere wollen eine Verwandtschaft mit dem Baskischen erkennen, das ebenfalls schwer zuzuordnen ist. Schließlich gibt es auch Wissenschaftler, die es aufgegeben haben, das Masirische klassifizieren zu wollen.
Das Masirische ist heute bedroht. In Algerien z.B. wurde in der Verfassung Ende 1996 das Arabische als einzige offizielle Sprache festgeschrieben. Jahrelange Schulboykotte junger Masiren in der Kabylei haben zwar durchgesetzt, dass zumindest in dieser Masirenhochburg an einigen Schulen Masirisch gelehrt wird. Ansonsten wird aber weiterhin in Arabisch oder Französisch unterrichtet.
Die eigene Sprache zu sprechen, ist ein Menschenrecht. Es ist noch ein weiter Weg, bis sich das Masirische als Schrift- und Verkehrssprache voll entfalten kann. Keine Sprache darf den Anspruch haben, besser als die andere zu sein. Wichtig ist die gegenseitige Anerkennung. Ein masirisches Sprichwort besagt: "A nedder s tbexsisin, wala a nili seddaw uzaglu!" Zu Deutsche heißt das: "Besser nur von Feigen leben als im Wohlstand Unterdrückung erdulden."
Beitrag von Akli Kebaili
Sinti und Roma kamen im 8. und 12. Jahrhundert aus ihrer ursprünglichen Heimat, dem indischen Punjab, über Pakistan, Iran, die Türkei und die Balkanländer nach Europa. Ihren Lebensunterhalt verdienten sie vor allem als Schmiede, Werkzeugmacher, Kesselflicker, Scherenschleifer, Korbflechter und Pferdehändler, manche auch als Musikanten und Künstler. Große Gruppen ließen sich im osteuropäischen Raum - den heutigen Ländern Rumänien, Bulgarien, auf dem Gebiet des früheren Jugoslawien, der Slowakischen und der Tschechischen Republik sowie in Ungarn - nieder. Andere zogen nach Westeuropa weiter.
Etwa ab dem 16. Jahrhundert wurden in ganz Europa "Zigeuner"-feindliche Gesetze erlassen. Die Polizei- und Landesverordnungen für Sachsen, Thüringen und Meissen aus dem Jahre 1589 sahen z. B. vor, dass ihnen Hab und Gut weggenommen werden konnte und dass sie "samt Weib und Kind außer Landes getrieben" werden sollten. Bis zum 18. Jahrhundert wurden sie in sämtlichen deutschen Ländern für vogelfrei erklärt.
Im Zeitalter der Aufklärung wurde mit entsprechenden Gesetzen (Sprachverbot, Zwangsehen mit Nicht-"Zigeunern", Wegnahme der Kinder) ihre Assimilation angestrebt. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts, als aus Ost- und Südosteuropa verstärkt Roma zuwanderten, begann man in Deutschland, zunächst die ausländischen Roma und ab Beginn des 20. Jahrhunderts auch die deutschen Sinti systematisch zu erfassen. Auf dieses während des Kaiserreichs und der Weimarer Republik aufgebaute behördliche Registrationsnetz konnten einige Jahrzehnte später die nationalsozialistischen Behörden bei der Ausführung ihrer Vernichtungspolitik zurückgreifen. Aus anderen europäischen Ländern - Skandinavien, Frankreich, Ungarn und den Balkanländern - sind ähnliche Gesetze, Erlasse und Verordnungen wie in den deutschen Fürstentümern bekannt.
Während des Dritten Reiches erreichte die menschenverachtende Behandlung der Sinti und Roma in Europa ihren Höhepunkt. Mehr als eine halbe Million von ihnen, darunter Zehntausende Kinder, wurden während des Nationalsozialismus in Deutschland und in den Staaten unter deutscher Besatzung umgebracht.
Anders als die NS-Verbrechen am jüdischen Volk wurde der Völkermord an den Sinti und Roma nach Ende des Dritten Reiches bis 1979 verleugnet. Ihre Diskriminierung und Verfolgung wurde fortgesetzt: Nach Kriegsende wurde in Bayern die Landfahrerzentrale als Nachfolgeinstitution der NS-Zigeunerzentrale eingerichtet. Sie arbeitete bis 1970 mit Nazi-Akten zahlreicher deutscher Sinti und Roma weiter. Viele von ihnen blieben zunächst staatenlos, weil ihnen die Staatsbürgerschaft unter Hitler entzogen worden war. Nur unter erheblichem öffentlichem Druck bekamen die letzten von ihnen in den 80er Jahren endlich ihre deutsche Staatsangehörigkeit wieder.
Die meisten Sinti und Roma wurden von den Landesentschädigungsämtern um die Wiedergutmachung selbst für schwerste gesundheitliche Folgeschäden betrogen. 1956 nämlich hatte der Bundesgerichtshof in einem krassen Fehlurteil geleugnet, dass Sinti und Roma schon vor 1943 aus rassischen - und nicht aus "kriminalpräventiven" - Gründen schweres Unrecht zugefügt worden war. Dieses Urteil wurde 1963 zwar aufgehoben, die auf ihm beruhenden Fehlentscheidungen jedoch nicht. 1981 wurde eine Härteregelung für Betroffene durchgesetzt, und der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma konnte in einzelnen Fällen Nachzahlungen erwirken. Dennoch mussten etliche Sinti und Roma noch bis in die 90er Jahre hinein um ihre Wiedergutmachung kämpfen.
Roma im ehemaligen Jugoslawien
Unmittelbar nach der Besetzung im April 1941 durch deutsche und italienische Truppen wurde in Jugoslawien die Vernichtungspolitik eingeleitet; grausam und systematisch wurden Juden und Roma umgebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Zerfall des ehemaligen Jugoslawien war die etwa eine Million große Minderheit der Roma nicht als nationale Minderheit anerkannt. Die wirtschaftliche Situation dieser Volksgruppe war miserabel: Die meisten Roma lebten in einem traurigen Kreislauf aus Armut, schlechter Wohnsituation, Arbeitslosigkeit und Diskriminierung, aus dem auszubrechen nur wenigen gelang.
In Bosnien-Herzegowina wurden die Roma ebenso wie die bosnischen Muslime Opfer "ethnischer Säuberungen". Vor dem Krieg lebten in Bosnien schätzungsweise 80.000 Roma, heute sind die meisten entweder gefallen, ermordet oder vertrieben. Auch in Teilen Serbiens sind Roma wie die Angehörigen anderer Minderheiten - die Albaner im Kosovo, die Muslime im Sandschak, die Ungarn in der Vojvodina - Opfer teilweise schwerer Menschenrechts-verletzungen.
Eine etwas andere Situation ist in der unabhängigen "Ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien" gegeben, die im Januar 1992 aus dem jugoslawischen "Rumpfpräsidium" ausgetreten ist. Ökonomisch ist Mazedonien in einer sehr schwierigen Situation, und tiefgreifende wirtschaftliche und strukturelle Hilfen des Auslands für Mazedonien gibt es kaum. Roma sind von den ökonomischen Problemen besonders hart betroffen. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, katastrophale hygienische Bedingungen in den Roma-Wohnvierteln, gravierende medizinische Unterversorgung und mangelnde Bildungschancen sind noch heute für die Lage der meisten Roma in Mazedonien charakteristisch. Darüber hinaus sind Roma immer wieder Diskriminierungen von Seiten der Ordnungskräfte ausgesetzt.
Roma in Rumänien
Bis zum Sturz Ceaucescus war den 1,5 bis 3 Millionen rumänischen Roma die Anerkennung als nationale Minderheit vorenthalten worden. Nach 1989 durften Roma erstmals in der Geschichte Rumäniens eigene kulturelle Einrichtungen gründen, Zeitungen in Romanes herausgeben und sich politisch organisieren. Ein wirklicher Demokratisierungsprozess hat in Rumänien jedoch bisher nicht stattgefunden. Die Menschenrechtslage der Roma hat sich aufgrund des Aufbrandens nationaler Konflikte sogar eher noch verschlechtert. In den Jahren 1990 bis 1994 kam es zu etwa 30 pogromartigen Ausschreitungen gegen Roma in rumänischen Städten und Dörfern. Die Polizei schützt die Betroffenen entweder gar nicht oder nicht wirksam genug; die dafür Verantwortlichen wurden nicht verurteilt. Zahlreiche Roma-Familien entschieden sich vor allem in den Jahren 1991 und 1992 für die Flucht, weil sie nicht länger in einer Atmosphäre der Angst vor ihren Nachbarn leben wollten. Dazu kommt die katastrophale sozioökonomische Lage der Roma: Viele leben unterhalb des Existenzminimums, die Arbeitslosigkeit ist überdurchschnittlich hoch.
Roma in den übrigen osteuropäischen Ländern
In allen
osteuropäischen Ländern, in denen Roma starke
Minderheiten stellen, wurden innerhalb kurzer Zeit politische
Parteien sowie demokratische und sozial-kulturelle Vereinigungen
gegründet. In Rumänien, in der Tschechischen Republik,
in der Slowakischen Republik sowie in Ungarn konnten Kandidaten
der Roma in das Parlament einziehen. Der politische Einfluss der
Roma ist allerdings in keinem der Länder Osteuropas
angemessen. Eine gezielte, intensivere kulturelle und
wirtschaftliche Förderung dieser Volksgruppe ist dringend
nötig, ebenso wie Initiativen zum Abbau von Vorurteilen
gegenüber Roma. In Ungarn sowie in der Tschechischen und der
Slowakischen Republik kommt es seit Jahren immer wieder zu
gewalttätigen Übergriffen von Skinheads auf diese
Volksgruppe. In Bulgarien sind Roma häufig Opfer
polizeilicher Schikanen und Übergriffe.
Weil sie friedlich gegen die chinesische Besetzung ihres Landes protestierten, verbüßen Hunderte Mönche und Nonnen zum Teil langjährige Haftstrafen. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 1995 wurden mehr als 110 Nonnen und Mönche festgenommen. Den Inhaftierten drohen Folter, Demütigung, Vergewaltigung, die Verschleppung in Arbeitslager oder sogar der Tod.
Seit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch chinesischer Truppen 1950 in Tibet führt China einen beispiellosen Vernichtungsfeldzug gegen die tibetische Bevölkerung, ihre buddhistische Kultur und Tradition. Allein zwischen 1959 und 1979 sind etwa eine Million Tibeter ermordet worden: Hunderttausende wurden in Arbeitslager verschleppt, in denen sie elend ums Leben kamen. Die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft führte zu Hungersnöten, die ein Massensterben verursachten. Nahezu 6 000 Klöster, Tempel und religiöse Stätten wurden völlig zerstört.
Jeglicher Widerstand gegen die chinesischen Besatzungstruppen wird blutig unterdrückt. Mindestens 500 000 chinesische Soldaten sind in Tibet stationiert. Jeder dritte Bewohner Lhasas ist Angehöriger der chinesischen Militär- und Sicherheitskräfte. Mit ihrer erdrückenden Präsenz sollen die Besatzungstruppen die Bevölkerung einschüchtern, jedes Aufbegehren soll bereits im Keim erstickt werden. So schießt die Polizei auf friedliche Demonstranten und inhaftiert angebliche Unterstützer der Unabhängigkeitsbewegung. Die Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Tibet ist nicht im geringsten garantiert. Es ist sogar lebensgefährlich, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu veröffentlichen. Zehn Mönche aus dem Kloster Drepung wurden deswegen zu 5 bis 19 Jahren Gefängnis verurteilt. Fünf Mönche des Klosters Dinggar, die bei einer Demonstration im März 1991 eine tibetische Flagge entrollten, müssen vier bis sechs Jahre hinter Gittern verbringen. Oft genügen noch geringere Anlässe, um jahrelang inhaftiert zu werden. So wurde der buddhistische Philosoph Dawa Tsering 1989 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, weil er sich mit einem Touristen in einem privaten Gespräch über die Perspektiven der Unabhängigkeit Tibets unterhalten hatte.
Die etwa sechs Millionen Tibeter sind zur Minderheit im eigenen Land gemacht worden. Unter Androhung harter Strafen wird ihnen eine strikte "Geburtenkontrolle" aufgezwungen. Regelmäßig werden Frauen in Krankenhäusern ohne ihr Wissen unmittelbar nach einer Entbindung sterilisiert. Planmäßig wird die Ansiedlung von Chinesen gefördert. Sie stellen mindestens zwei Drittel der etwa 170 000 Bewohner Lhasas. Auch in anderen großen Städten Tibets bilden die Chinesen inzwischen die größte Bevölkerungsgruppe.
Schon heute leben sieben Millionen Chinesen in Tibet. Dies hat auch katastrophale ökologische Folgen. Ohne Rücksicht auf das empfindliche Ökosystem wird immer mehr Land für Ackerbau, Viehzucht und die Erschließung von Bodenschätzen genutzt. Nahezu 50 Prozent der Waldfläche Tibets wurden bereits abgeholzt. In manchen Regionen wurden schon zwei Drittel des Waldbestandes gerodet. Das dicht besiedelte Ostchina, das selbst kaum noch über Wälder verfügt, deckt seinen Holzbedarf in Tibet.
Im Rahmen dieser Sinisierungspolitik hat China auch das Bildungssystem gleichgeschaltet. Zwar wird Tibetisch an den Schulen gelehrt, doch werden alle anderen Fächer in Chinesisch unterrichtet. So benötigen chinesische Kinder keine tibetischen Sprachkenntnisse, während junge Tibeter fast nur in der Fremdsprache Chinesisch unterrichtet werden. Menschenrechtsorganisationen warnen davor, dass angesichts der Unterdrückung der tibetischen Religion und Sprache nach der Jahrtausendwende die traditionelle Kultur der Tibeter vernichtet sein könnte.
Beitrag von Ulrich Delius, 1996
Seit fast 20 Jahren hält Indonesien den östlichen Teil der Insel Timor völkerrechtswidrig besetzt. Der Widerstand der einheimischen Bevölkerung wurde in einem beispiellosen Blutbad erstickt. Seit der Annexion Osttimors durch indonesische Truppen im November 1975 starben dort rund 200.000 Menschen, ein Viertel der Bevölkerung, durch willkürliche Erschießungen, Folter, Hunger und Seuchen.Die Tragödie des osttimoresischen Volkes begann mit dem Rückzug der portugiesischen Kolonialmacht aus dem Land im Jahre 1975. Die Portugiesen gaben sich alle Mühe, stabile politische Verhältnisse zu hinterlassen und ließen im Juli 1975 Gemeinderatswahlen abhalten. Eindeutiger Sieger dieser Wahlen wurde mit 55 Prozent der Stimmen die FRETILIN, die ein unabhängiges Osttimor nach einer fünfjährigen Übergangszeit anstrebte. Die UDT, die eine Föderation mit Portugal zum Ziel hatte, erreichte 40 Prozent, für die APODETI, die einen Anschluss an Indonesien befürwortete, stimmten nur fünf Prozent der Wähler. Ein Putschversuch der unterlegenen APODETI konnte von der FRETILIN noch erfolgreich abgewehrt werden. Nur zehn Tage nach der Proklamation der "Demokratischen Republik Osttimor" überfielen jedoch indonesische Truppen am 7. Dezember 1975 das Land, die Suharto-Diktatur erklärte Osttimor zur "27. Provinz Indonesiens".
Die neuen Kolonialherren wüteten mit kaum vorstellbarer Grausamkeit: Rund 80.000 Menschen wurden innerhalb von 18 Monaten erschossen oder zu Tode gefoltert, 200.000 Osttimoresen hielt die indonesische Regierung unter unmenschlichen Bedingungen in Lagern fest. Die indonesische Luftwaffe zerstörte systematisch die Felder und Ernten des Landes. Der gesamte Warenaustausch mit dem Ausland wurde unterbunden, Hilfstransporte wurden nicht ins Land gelassen. Tausende von Menschen starben an Hunger und Seuchen.
Vorläufig letzter Höhepunkt des indonesischen Schreckensregimes war das Massaker in der osttimoresischen Hauptstadt Dili im November 1991: Indonesiche Soldaten feuerten ohne Warnung in eine friedliche Prozession von etwa 2000 Menschen. Nach dem Bericht einer Untersuchungskommission des australischen Parlaments wurden bei dem Massaker 279 Menschen getötet. Ein Jahr nach dem Massaker von Dili konnte die Suharto-Diktatur auch den Führer des Widerstandes gegen das Besatzungsregime ausschalten: Xanana Gusmao wurde in seinem Versteck in Dili aufgespürt und in einem Schauprozess zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die indonesischen Behörden verweigerten neutralen Beobachtern wie Geoffrey Robinson als Vertreter von amnesty international die Teilnahme am Prozess.
Die UNO und das Europäische Parlament verlangten von der Regierung in Jakarta "rückhaltlose Aufklärung" des Massakers von Dili, die frühere Kolonialmacht Portugal erklärte den Tag von Dili zum "nationalen Gedenktag". Zusätzlich verurteilte die Menschenrechtskommission der UNO am 11.03.1993 Indonesien wegen der Menschenrechtsverletzungen in Osttimor. Konkrete Folgen ergaben sich daraus für die indonesischen Besatzer aber nicht. Indonesien ist nach wie vor ein begehrter Handelspartner der westlichen Industriestaaten: Europäische, amerikanische und japanische Unternehmen investieren mit zweistelligen Zuwachsraten in dem diktatorisch regierten Land.
Göttingen, 1995
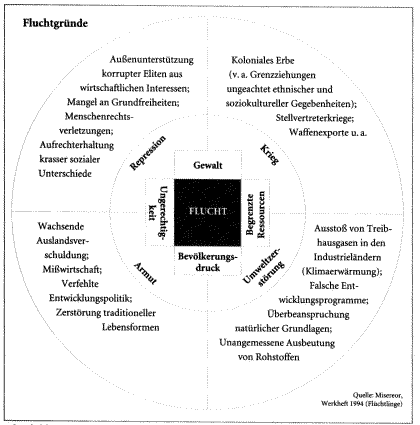
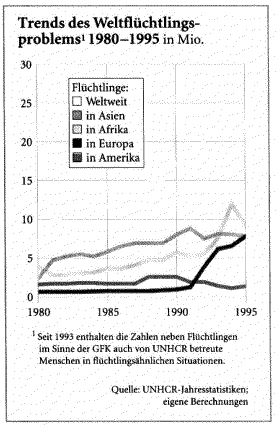

Aus: Globale Trends 1998
|